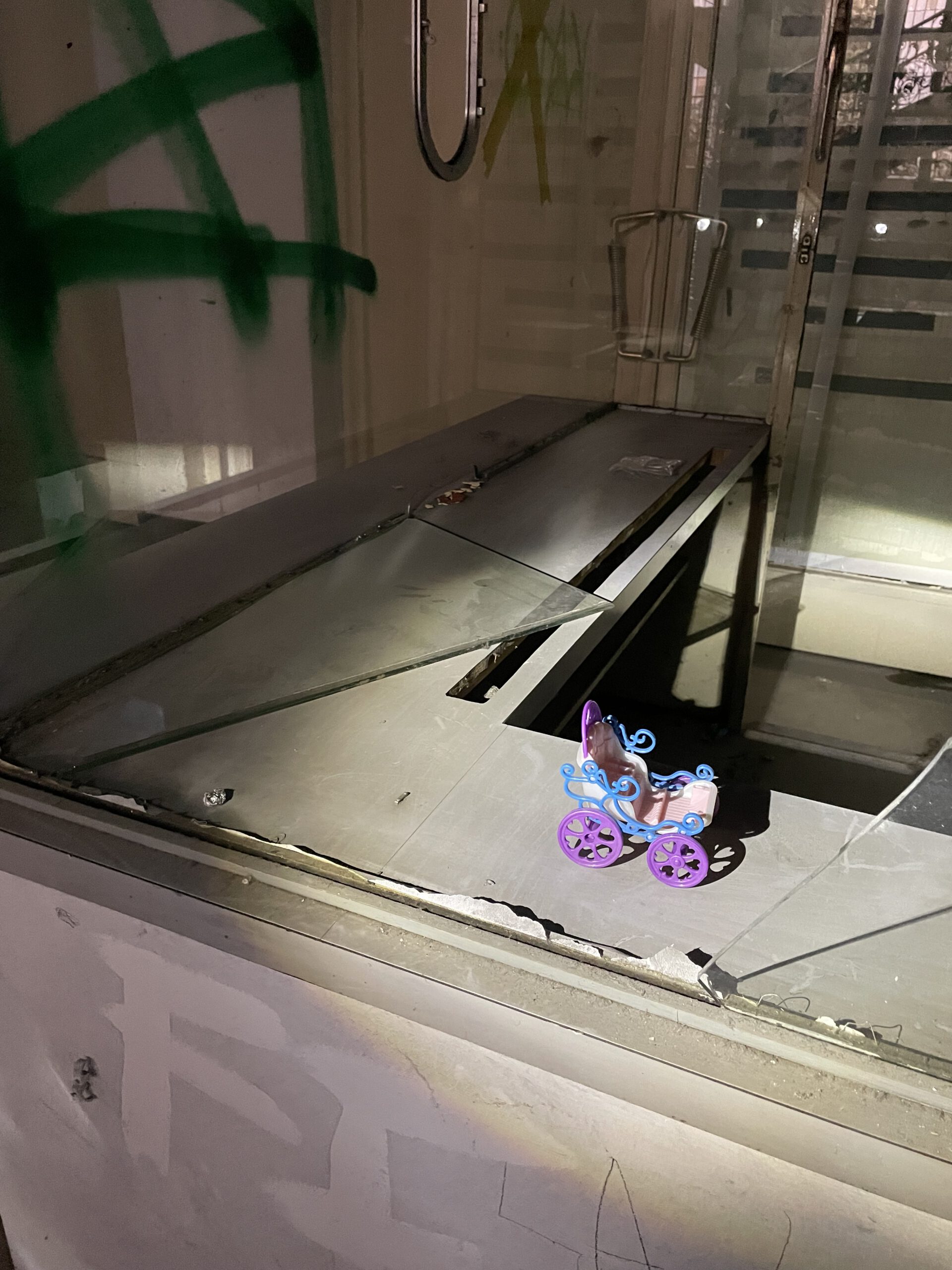Die Tischlampe muss weg
Sie saß in einem Sessel, hatte die Beine auf einem niedrigen Hocker lang ausgestreckt, wie Jesus bei Mantegnas „Beweinung Christi“. Er lag allerdings dort auf einer Bahre und zeigte seinem Betrachter die nackten Fußsohlen. Sie hatte Socken an.
Sie saß also fast liegend in ihrem Sessel und strickte, mich mit dem äußerst kritischen Blick meiner Mutter betrachtend. Ich sah sie stricken, sah sie von einer höheren Stelle aus, so als hätte ich eine Semi-Vogelperspektive, stünde ihr gegenüber und wäre mindestens zwei Meter zwanzig groß, oder säße auf einem Regal auf diese Höhe an der Wand. Mich selbst sah ich allerdings nicht, kein bisschen. Dass ich da war, ihr gegenüberstand oder im Regal saß, ist eine Annahme, um die genaue Lage zu beschreiben, von wo ich sie sah, rein von der Blickperspektive her, wo eine Kamera stünde, wenn das Ganze ein Film wäre und ich sie auf einem Bildschirm übertragen bekommen hätte. Denn ich war ja gar nicht da. Aber, es war auch kein Bildschirm da, es war rein gar nichts zwischen ihr und mir, ich sah sie direkt vor mir, so wie oben beschrieben, sah sie stricken, den Blick und ihre Fußsohlen auf mich gerichtet.
„Du musst sie umbringen“, sagte sie und ich hörte ihre langen metallenen Stricknadeln klappern. Ich wusste ganz genau, wen sie meinte, stellte mich allerdings dumm, wie immer.
„Sie macht alles kaputt. Die Tischlampe muss weg.“
„Du hast sicher recht, aber wie?“ Hier log ich. Aber ich musste so tun, als würde ich sie ernst nehmen. So lief es zwischen uns.
„Mach dir doch einen Plan!“ rief sie mir zu und legte genervt ihr Strickzeug aus der Hand. Umständlich und langsam zog sie ihre Beine vom Hocker und setzte sie auf dem Boden.
„Ich muss mir mal eben die Beine vertreten. Und bis ich zurück bin, hast du einen Plan.“
Dann ging sie spazieren. Ich spürte sie meinen linken Arm herunterlaufen, bis zur Spitze meines linken Daumens. Dann wanderte sie wieder hoch, um an der Wirbelsäule entlang runterzulaufen, über die rechte Hinterbacke zum rechten Knie. Das sollte sie ruhig, das ist Sport für sie. Viel lieber wäre sie frei, dachte ich und fühlte sie bedächtig entlang schreiten, mit den Schritten einer älteren Frau, den Kopf leicht nach vorn gebeugt, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Wenn sie wieder zurück war, würde ich die stets bewährte Methode anwenden, rückwärts zu zähle. Das war meine Exit-Strategie, wenn sonst nichts weiterhalf.
Um die Geschichte verständlicher zu machen, müsste ich sie von ganz Anfang an erzählen. Ich wohnte schon seit geraumer Zeit in einem kleinen Zimmer, das von meiner Vermieterin bereits möbliert war, als ich es bezog. Es gab darin ein einfaches schmales Bett in einem Holzrahmen ohne Kopf und Fußteil, darin ein Lattenrost, darauf eine Matratze, die leicht durchgelegen war – aber noch ging es, ich konnte auf ihr schlafen, hatte keine Rückenbeschwerden. Neben dem Bett befand sich eine Nachtkommode mit einer Schublade, darin meine Schaf- und Lesebrille sowie die Ohrenstöpsel. An der Wand gegenüber gab es einen kleinen Schrank, am Fenster, das sich zwischen den beiden befand, einen Tisch, an dem ich arbeitete. An der linken Ecke des Tisches stand mein Zitronenbäumchen, das ich aus Italien mitgebracht und Zitronella genannt hatte. Da Zitronella damals noch sehr klein war, konnte sie sich gar nicht daran erinnern. Mag sein, dass sie deswegen hier in meinem Zimmer überhaupt überleben konnte, weil sie das andere, ursprüngliche nicht kannte.
Ich war ein ordentlicher Mensch. Meine Sachen waren aufgeräumt, zu Hause zog ich die Schuhe aus und packe sie in den Schrank. Meine Hausschlappen standen neben der Tür, und ich zog sie ausschließlich zu Hause an. Am Boden lag ein Teppich mit orientalischen Ornamenten. Er sah sehr alt aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt echt war. Vermutlich nicht, wahrscheinlich aus einer Massenproduktion, aber es war mir egal, ob der Teppich handgeknüpft oder aus der der Maschine gekommen war. Mir gefielen die Muster, die sich in Tönen von weiß, rot, braun, grün, blau und schwarz öffneten und schlossen, sich in der Mitte zu einem Größeren und Ganzen trafen und an den beiden schmalen Enden ausfransten.
An manchen Tagen saß ich auf dem Bett und schaute mir diesen geordneten Wirrwarr unter meinen Füßen an. Ich sah sich Wiederholendes, sich Abstoßendes, ineinander Greifendes, voneinander Fließendes. Ich erkannte darin Geschichten, die ich nacherzählte, ganze Kladden hatte ich bereits geschrieben. Den einzelnen Figuren gab ich Namen, erfand für sie Eigenschaften, entwickelte Dramatik, Lust, Trauer und Boshaftigkeit, erzählte warum eine kleine Linie von einem schweren Kreuz bedrängt wurde und rote Knoten in Form einer Armee sich in ihrer Richtung neigten, um ihr zu Hilfe zu eilen. Darin und daraus knöpfte ich meine Dichtung, denn hier unter meinen Füßen war sie besonders dicht gewebt. Jeder Knoten saß am rechten Fleck, alles war einem Ganzen und Großen untergeordnet, fast ein göttlicher Gedanke. Möglich, dass die Wirklichkeit ebenfalls ein Teppich war.
So lebte ich mein ruhiges Leben. Morgens stand ich früh auf, öffnete das Fenster, auch im Winter, ließ die ausgeatmete Luft aus meinen Lungen hinausrinnen und sog ungebrauchte hinein. Die Vögel zwitscherten. Ich trank meinen Kaffee und fing an zu schreiben. Um Mittag herum aß ich eine Kleinigkeit, dann machte ich einen Spaziergang zu einer nahegelegenen Parkanlage. Zurück zu Hause las ich im Bett, danach trank ich einen Tee, manchmal auch Kaffee und schrieb weiter an meinen Geschichten oder notierte nur, was mir durch den Kopf ging. Nach dem Abendessen las ich im Bett, bis mir die Augen zufielen. Ich hatte kein aufregendes Leben, aber ich mochte kein anderes. Nur dieses, und zwar so, wie es war. Ich war glücklich, denn Glück entstand nicht aus Äußerem, es war in mir verborgen. Ich hatte meins gefunden, mich mit ihm arrangiert und hätte bis ans Ende aller Tage so weiterleben können. Aber es kam anders. Es fing mit Zitronella an.
Zitronella, mein Zitronenbäumchen stand früher auf dem Balkon, neben dem Bambus. Damals, als ich noch auf den Balkon durfte – später hatte meine Wirtin ihn einem anderen Zimmer zugeteilt – las ich gerne dort, wenn es die Temperatur erlaubte. Ich setzte mich dann auf dem Holzstuhl direkt neben Zitronella, die in einem Topf auf dem Boden stand. Ich lächelte sie an, grüßte sie mit einem Kopfnicken, weil sie doch lebte, so wie ich. Wir Lebenden sollten respektvoll miteinander umgehen. Und so begrüßte ich sie jedes Mal, trank meinen Kaffee oder Tee, und rauchte sogar ab und an eine Zigarette.
An einem dieser Frühlingstage, an dem ich ohne Mütze und dicke Jacke auf meinem Stuhl saß und versuchte Rauchringe ineinander zu blasen, sprach mich zum ersten Mal mein Zitronenbäumchen an. Es war allerdings nicht so ein Sprechen wie mit meiner Wirtin, laut und deutlich und durchaus als Sprache vernehmbar. Daher dauerte es ein wenig, bis dass ich die Stimme, als die von Zitronella wahrnehmen und meinem Bäumchen zuordnen konnte. Sie war wie ein leichtes Pfeifen des Windes, das sich formatiert hatte zu meiner Sprache und zu meinem Verständnis.
Als Zitronella zu mir sprach, horchte mein Inneres Ich auf, legte die Hände auf die Armlehnen und schaute mich mit gekräuselter Stirn an. Ich starrte zurück und wir nahmen war, was das kleine Zitronenbäumchen mir sagte.
„Der Bambus ist zu groß, er ist zu groß, er muss weg.“
Der Bambus war um den Balkon herum gepflanzt worden, als Sichtschutz von außen und war tatsächlich sehr hochgewachsen und sein Schatten fiel den ganzen Tag auf das Zitrusbäumchen. Es kam aber aus einem sonnigen Land und brauchte daher viel Licht.
Natürlich konnte ich den Bambus nicht vernichten, also nahm ich Zitronella zu mir ins Zimmer und stellte sie direkt auf dem Tisch, wo sie den ganzen Tag über der Sonne ausgesetzt war. Ich erzählte ihr hin und wieder, dass auch ich aus einem Dorf komme, wo den ganzen Tag die Sonne scheint und wo es ganz viele große Zitronenbäume gab.
„Erzähl mir mehr“, bat sie mich und ich erwähnte, wie mein Onkel die unterschiedlichsten Zitrusfrüchte gepflanzt hatte, die im Winter schwer an ihren Früchten hingen und das ganze Dorf nicht müde wurde, süßsäuerliches Obst in allen erdenklichen Varianten zu essen.
„Der Duft erst“, sagte ich wehmütig und roch an ihren Blättern. So hatte die Zeit ewig weiterlaufen können, ich war fürchterlich glücklich in meinem Zimmer. Oft saß ich am Tisch, schaute hinaus auf die sich verändernde Welt und sprach mit meinem Bäumchen. Wenn es wollte, las ich ihm meine gedichteten Teppichlegenden vor. Eines Tages, als ich für einen kleinen Spaziergag draußen war und fast erfroren zurückkam, stand auf der rechten Seite des Tisches eine Tischlampe.
Sie war nicht schön, bestand aus braunem Plastik, leicht durchsichtig, gegossen im Stil einer alten und vor allem altmodischen Schirmlampe. Sie hatte einen winzigen Schirm, der lediglich die schwache Birne bedeckte, umzingelt von winzigen Plastiktropfen, die wohl die üblichen Fransen darstellen sollten, jedoch starr waren, um überzeugend zu wirken. Eine schlechte Kopie, dachte ich, hübsch war sie ja nicht, und passte überhaupt nicht in mein Zimmer, das eher altmodisch möbliert war, zusammengestellt aus Holzmöbeln, meist aus Stücken, die meine Wirtin aus der Auflösung ihres Elternhauses mitgenommen hatte. Das Zimmer hatte einen gewissen Charme von altem, von alltäglich gealtertem, mit geschundenen Oberflächen am Schrank und Tischplatte. Nicht so diese Tischlampe, die, wenn auch durchaus gebraucht, weil vermutlich vom Flohmarkt, nicht die Bohne von einer Patina angesetzt hatte und höchstens Staub anzog.
Meine Vermieterin hatte gewiss in guter Absicht die Tischlampe bei mir hingestellt. Sie sollte mir am Tisch Licht spenden, wenn ich zur dunklen Stunde etwas aufschreiben wollte, wohin die Deckenleuchte nicht reichte, weil ich auch mit dem Rücken zu ihr saß. Aber schnell hatte ich gemerkt, dass diese Tischlampe nur den Bereich von 30 cm unter ihrem Schirm beleuchtete und mir nicht von großem Nutzen war. Daher benutzte ich sie kaum.
Eines Herbsttages, draußen ein stetiges Regenrauschen, die Bäume fast kahl und die wenigen verbliebenen Blätter an den Rändern schimmelig gefärbt – sie sahen so bedauerlich aus, dass ich mir die Äste viel lieber gleich ganz kahl wünschte. Da hörte ich mein immergrünes schönes Zitronenbäumchen Zitronella zu mir flüstern.
„Die Tischlampe muss weg.“
„Die Tischlampe muss weg“, wiederholte sie, als ich beim ersten Mal nicht reagiert hatte.
„Was?“ frage ich meine Zitronella und spürte, wie mein inneres Ich aufmerksam stehenblieb. Es kam gerade aus seiner Wanderung zu der rechten Ferse zurück und war dabei, im alten Cordsessel Platz zu nehmen. Das Bäumchen berichtete unbeirrt von bösen Absichten der Tischlampe. Sie würde um sich schleimen und Verbündete suchen. Sie hätte bereits mit dem Tisch, dem Regal und sogar mit der Kaffeetasse, die nun nicht permanent im Zimmer verweilte, wie die anderen, über uns getuschelt.
Ich lachte auf, denn da sprach das Zitrusbäumchen Zitronella, das sich auch über den Bambus beschwert und mir sogar vorgeschlagen hatte, ihn zu vernichten. Damals konnte ich sie verstehen, denn der Bambus warf seinen Schatten auf sie und schnitt sie vom Licht ab. Aber hier? Sie war direkt am Fenster und die Tischlampe an der Wand rechts, also nicht neben ihr. Dazwischen jede Menge Platz und überhaupt keine Berührungspunkte der beiden.
„Die Tischlampe tötet“, sagte mir nun mein Inneres Ich, mit aufgerissenen Augen. „Das Bäumchen hat es gesehen. Die Tischlampe will alles töten, was lebt.“ Da hatte meine kleine Zitronella wohl direkt mein Inneres Ich kontaktiert und ihm bereits alles erzählt.
„Warum sollte sie?“ fragte ich. Mein Inneres Ich krallte die Hände in die Sessellehnen. Es hatte wieder Platz genommen.
„Weil sie aus Plastik ist, aus toter Materie. Sie hat nie gelebt. Sie ist neidisch.“
Ich dachte nach und erwiderte schließlich:
„Das ganze Zimmer besteht aus toter Materie und nie war davon etwas neidisch auf die Lebenden.“
„Weil sie das Leben kennen, weil sie mal gelebt hatten. All das Holz, der Teppich.“
„Und die Tischlampe nicht?“ fragte ich ungläubig mein mich anstarrendes Inneres Ich, als wäre ich etwas senil im Kopf.
„Überleg mal?“
Mir fiel nichts ein. Ich schaute zu meiner rechten, wo die Tischlampe ein schwaches Licht von sich gab. Aber, nein, ich hatte keine Erklärung, was an der besonders oder überhaupt anders sein sollte. Sie war eine aus Plastik gegossene Lampe, die eine andere aus Pergamentschirm imitierte. Hässlich, zugegeben, aber was sonst noch?
„Sie hat nie gelebt“, schleuderte mir mein Inneres Ich entgegen. Und warum sollte das ein Grund sein, alles Lebendige auslöschen zu wollen? Mein Geschirr tat es doch auch nicht, oder das Kabelgehäuse an der Wand.
Mein Inneres Ich spinnt, dachte ich und beschloss, seine Stimme zu ignorieren. So verging eine Weile, der Winter kam und ging, und dann das nächste Frühjahr. Zitronella erwähnte das Thema nicht mehr und beließ es bei einem täglichen Gruß. Im Sommer wurden ihre Blätter heller. Ich sprach sie an, was los sei. Sie mache sich große Sorgen, sagte sie, inzwischen hätte die Tischlampe viele der Gegenstände im Zimmer auf ihrer Seite. Sie würden eine Kampagne gegen die Fliegen fahren. Ich persönlich hatte nichts gegen Fliegen, denn sie gehörten zum Sommer wie das Atmen zum Leben. Ich kannte es nicht anders. Warum sollten sie eine Tischlampe oder meine restlichen Möbel stören? Ich schüttelte ungläubig mit dem Kopf.
Sie hätten alle Angst, nicht nur sie, gestand sie. Die Fliegen natürlich, weil sie direkt betroffen waren, aber auch die Spinnen, Motten, eben alles, was noch in meinem Zimmer lebte, hätte Angst vor der Tischlampe und ihren Machenschaften.
„Wenn es so ist, lass uns doch mit ihnen sprechen. Und wenn sie ein Problem mit uns haben sollten, werden wir es durchaus in einem Gespräch beseitigen. Wir sind zivilisiert, in diesem Zimmer sind die Gegenstände, alle wie sie da sind, Produkte unserer Zivilisation. Und durch Sprechen miteinander werden wir unsere Differenzen sicherlich ausräumen. Und friedlich zusammen weiterleben, wie auch vorher.“
„Die Tischlampe muss weg“, sagte ganz deutlich Zitronella und mein Inneres Ich bestätige es.
„Die Tischlampe muss weg!“
Nun, so im Nachhinein denke ich, ich hätte dieser Idee, oder besser: dieser Warnung mehr Gehör schenken sollen. Aber, so zivilisiert wie ich war (und immer noch bin, denn das kann nicht einfach so abgelegt werden, wie eine alte Jacke) konnte ich Zitronella und mein Inneres Ich nicht erst nehmen. Zumal Zitronella schon mal Ärger mit dem Bambus hatte. Und mit diesem Vorkommnis aus der Vergangenheit hatte das Zitronenbäumchen wenig Glaubwürdigkeit bei mir, auch wenn mein Inneres Ich jedes Wort von ihr glaubte und mich immer wieder warnte. Ich hingegen versuchte es durch einen Dialog, sprach mit meinem Tisch, suchte eine gepflegte Unterredung mit dem Mülleimer, der allerdings den Mund nur aufmachte, wenn ich auf seinen Treter trat. Sie alle grummelten, protestierten, suchten ihr Recht, wollten das Zimmer für sich haben, und zwar nur für sich.
So hörte ich von der Gardine, wir wären Eindringlinge, wären von Außerhalb gekommen, sie und die anderen Möbelstücke wären schon immer da gewesen. Sie machten das Zimmer aus, nicht wir.
„Ihr gehört nicht dazu und werdet nie so sein wie wir!“
„Was meinst du mit ihr?“, fragte ich mit einem Lächeln, denn ich zahlte schließlich Miete für das Zimmer, es war mein Zimmer. Und da wurde mir bewusst, dass ich mit einer Gardine sprach, die ihre besten Tage schon hinter sich gelassen hatte.
„Na, ihr, die hier rein und rausgeht! Dieser stinkende Baum, ganz zu schweigen von dem fliegenden oder kriechenden Zeug. Und natürlich auch du!“
„Was sagst du nun dazu?“ grinste mich mein Inneres Ich an.
Das ist ein anderes Kapitel, dazu kam ich bisher nicht, denn mein Inneres Ich hat es nie gegeben, es ist nur eine Einbildung. Ich kann es nicht ganz aus der Welt schaffen, aber versuchen zu ignorieren. Meistens gelingt es mir über Tage, sogar Monate, doch als die Gardine mir drohte, da hatte sich mein Inneres Ich sofort gemeldet. Ich war emotional nicht gefestigt genug, seine Stimme zu ignorieren.
„Das wird noch böse enden“, sagte sie. Sie saß wieder in ihrem alten Sessel, hatte ihren Rundgang hinter sich und schien ziemlich deprimiert. Überhaupt hatte mein Inneres Ich nur zwei Gemütszustände. Harsch oder deprimiert. Heute schwankte sie zwischen den beiden wie ein JoJo.
Teils schimpfte sie mich aus, dass ich zu leichtgläubig sei, die Gefahr nicht erkannte und alle ins Verderben stürzen würde. Und im nächsten Moment war sie tieftraurig, weil sie wusste, dass es genauso kommen würde. Sie wusste, sie saß in mir fest und war somit im Grunde machtlos, außer sie könnte mich doch noch überzeugen, zu handeln.
„Die Tischlampe muss weg!“, sagte sie entschlossen und stand auf. Mit aufgerissenen Augen starrte sie mich an, in denen sich Panik ausbreitete.
„Die Tischlampe muss weg, hörst du? Mach, dass sie weg ist. Schmeiß sie raus auf die Müllhalde, mach sie kaputt, dass sie niemandem mehr schaden kann.“
Nun hatte sie auch ihren Zeigefinger erhoben und kam mir näher, als es mir lieb war. Mein Inneres Ich stellte allerdings keine Gefahr dar, weder für mich noch für andere. Es war nur eingesperrt in mir und ich war vernünftig genug zu wissen, dass es zwar da war, ich ihm allerdings nicht gehorchen musste. Die Therapie hatte schließlich gewirkt und mir einen lässigen Umgang mit meinem Inneren Ich beigebracht.
Ich sagte also nichts, zählte von 100 ab rückwärts und lächelte. Irgendwann würde sie aufhören und wieder auf Wanderschaft in meinem Körper gehen und in den Hohlräumen ihren Frust ausschreien. Sie tat mir leid, ich wünsche niemandem ein Gefängnis wie das meines Körpers. Ich wusste, dass sie darin unglücklich war. Als ich später ins Bett ging, spürte ich sie noch lange die Beine auf und ab wandern, an die Zehenspitzen klopfen, am Rücken entlangschlendern. In die inneren Organe kam sie nicht rein. Sie konnte weder ganz raus aus mir noch ganz hinein. Sie war im Limbus gefangen, in meiner eigenen Vorhölle unter der Haut, weswegen ich nicht allzu streng mit ihr war und ihre Schimpftiraden über mich ergehen ließ, indem ich rückwärts zählte. Von 100 ab, langsam, mit Atemübungen. Oft reichte es bis 75. Jetzt war ich bei 57 und sie immer noch in meinem Gesichtsfeld. Ihr Lehnsessel war zwar leer, aber sie war noch da, aufrecht mit erhobenem Zeigefinger, direkt vor meiner Nase. Ich wollte nur, dass sie mich in Ruhe ließ und ich meinem täglichen Leben ungestört nachgehen konnte.
Ich hatte gute Gründe, auf sie nicht gehört zu haben, als sie mich warnte. Nicht einmal sondern immer wieder beschwor sie mich und zum Schluss sogar eindringlich, die Tischlampe wegzuschmeißen, direkt auf die Müllhalde. Es war lächerlich anzunehmen, von einer Plastik Tischlampe von irgendeinem Trödelmarkt bedroht zu werden.
„Da, siehst du all die toten Insekten unter ihrem Schirm?“ schleuderte sie mir bei 41 entgegen. Ich konnte mich nicht erinnern jemals bei so tiefen Zahlen angekommen zu sein. Ich atmete ein und langsam aus, und sagte 40. Sie ging. Mein Sichtfeld war frei.
Gut, das war erledigt, zumindest dieses Mal. Ich schaute auf den Haufen toter Insekten, darunter allerlei Sorten, die ich nicht kannte. Erst war ich bestürzt, hatten Zitronella und mein Inneres Ich wohl doch recht? Das wäre entsetzlich. Aber, dann erinnerte ich mich, wie Licht Insekten anzog, wie die Zimmerdecke in meiner Kindheit im Dorf morgens fast schwarz war, voll von dicken Nachtfaltern, weil wir an heißen Sommerabenden die Fenster geöffnet und das Röhrenlicht an der Decke hatten brennen lassen. So sah ich morgens, wenn ich wach wurde, hunderte von Nachtschwärmern über mir schlummern. Und irgendwann, das konnte ich nicht verfolgen, waren sie tagsüber wieder verschwunden, um später zurückzukommen. Die grellen Neonröhren zogen sie an, Nacht für Nacht, einen ganzen Sommer lang.
So war das hier auch mit den Insekten. Nur, dass sie in meiner Kindheit nicht gestorben waren. Sie hingen an der Decke, als ich aufstand, lagen nicht leblos auf meinem Bett.
Darauf kam ich allerdings nicht, als ich den toten Haufen Insekten sah. Ich ging davon aus, dass sie vom Licht angezogen worden waren und daran starben. Außerdem fand ich nichts Schlimmes dabei. Es waren eben doch nur Insekten, sie lebten eh nicht lange und wurden tagtäglich verjagt, vergiftet, verschluckt. Sie waren nicht gerade sehr beliebt. Niemand hielt sich Insekten als Haustiere (bis auf ein paar merkwürdige Typen vielleicht…)
Außerdem gab es ja wohl genug Insekten, als dass ich eine Handvoll tote unter dem Plastikschirm hätte bedauern müssen. Die meisten Menschen jagten sie mit Fliegenklatschen, aber in meinem Zimmer waren sie mir nie negativ aufgefallen, so dass ich etwas gegen sie unternommen hätte. Ich nahm sie wahr, die Fliegen, die Fruchtfliegen, die Motten, die kleinen Spinnen, die jedoch sehr scheu waren. Ja, unter den toten Insekten waren auch Spinnen, aber ich hatte es damals nicht analysiert und Lehren daraus gezogen, oder mein Inneres Ich konsultiert. Es ließ mich in Ruhe, was ich damals genossen und als einen Sieg für mich verbucht hatte. Vermutlich war es nur beleidigt und hatte sich in eine Ecke verzogen.
Im Nachhinein denke ich, ich hätte meine zivilisierte Arroganz ablegen und sie fragen sollen, warum da auch tote Spinnen lagen, die gewöhnlich nicht vom Licht angezogen wurden. Ganz im Gegenteil, sie sponnen ihre Netze eher in Nischen und lauerten dort auf ihre Beute. Waren sie wohl wegen der fetten Beute gekommen, die dort lag? Würden Spinnen tote Insekten fressen? Warum waren sie aber dann selbst tot? Es muss etwas dagewesen sein, was dazu führte, das eben auch sie starben. Lag es an den toten Fliegen, die sie gefressen hatten? War da Gift drin, die die Spinnen ebenfalls hingerafft hatte?
Eine andere Frage war, woher hatten die Spinnen gewusst, dass dort so viel Nahrung für sie lag? Normal ernährten sie sich von dem, was sie in ihrem Netz fingen und gingen nicht auf die Suche in Gegenden, die sie nicht kannten. Warum war das hier anders? Woher wussten sie das? Hatte jemand es ihnen erzählt und sie damit in die Falle gelockt?
Mein Blick fiel auf den Boden. An der Fußleiste entlang lagen ebenfalls tote Fliegen. Die Spinnen müssen diese bemerkt haben und entlang dieser Spur auf dem Tisch gelangt sein, wo sie durch vergiftete Köderfliegen umgekommen waren.
Es stimmte also, was mir Zitronella und mein Inneres Ich schon so lange über die Tischlampe zugeflüstert hatten. Ich musste sie tatsächlich entsorgen, sonst würde sie weiteres Unheil über uns bringen.
„Möchtest du jetzt endlich etwas unternehmen?“ flüsterte mir Zitronella zu, die trotz meiner guten Pflege viele Blätter abgeworfen hatte – und die wenigen verbliebenen hatten statt ihrem satten dunklen Grün eine schlammige Version davon angenommen. Das waren alles Zeichen gewesen, die ich ignoriert hatte. Die Tischlampe musste ein giftiges Licht ausgestrahlt haben, das die Pflanze in ihrem Wachstum gestört, ja fast getötet hatte.
„Die Tischlampe muss weg!“ sagte ich und schlug mit der Faust auf den Tisch. Wie eine Kampfansage schaltete sie sich an und verstrahlte ein gelbfiebriges Licht, wie das einer Nuklearanlage. Augenblicklich bekam ich einen Stich in die Stirn, genau zwischen den Brauen. Bevor ich irgendwie reagieren konnte, kippte der Stuhl nach rechts, obwohl ich mich nicht bewegt hatte. Von der Tischplatte her wehte mir Staub ins Gesicht. Das Atmen wurde schwer. Ich hustete heftig, fiel vom Stuhl und landete mit Krach auf dem Boden. Ich musste die Steckdose finden und diesem Monster die Stromversorgung abschalten. Mühsam robbte ich unter den Tisch und tastete mich am Kabel entlang zur Wand. Da plötzlich schlug es Funken, meine Hand brannte, ich zog sie mit einem Schrei weg.
Aus der Steckdose kamen Feuerzungen und leckten am Teppich. Er fing an zu brennen. Ich stand auf. An der Lampe war die Glühbirne zerplatzt. Auch von dort knisterte es, Funken peitschten um sich und erreichten meine Notizen. Doch bevor ich etwas unternehmen konnte, hatte die Gardine Feuer gefangen. Unmöglich die Notizbücher zu retten. Am Boden fraß sich das Feuer im Teppich bis zum Bett, das nun ebenfalls aufflammte. Am umgekippten Stuhl züngelten die Feuerflammen am gebrochenen Bein hoch, dunkler Rauch verbreitete sich im Raum. Ich musste raus.
Hustend schnappte ich mir Zitronella, die die ganze Zeit schon „raus, raus, raus hier, wir müssen hier raus!“ schrie, die ich aber erst jetzt hörte. Ich öffnete die Tür, lief in den Flur und kaum war ich draußen, brannte schon die Zimmertür. Drinnen sah ich nichts als Feuer und schwarzen Rauch.
„Raus hier, wir müssen das Haus verlassen!“ schrie Zitronella in meiner rechten Armbeuge, denn mit der Linken musste ich mir meinen Mund zuhalten. Ich rannte keuchend die Treppe runter. Jeder Atemzug brannte in den Nasenlöchern und in der Lunge. Endlich draußen. Die Feuerwehrsirenen waren zu hören, aber ich sah niemanden. Das Fenster meines Zimmers war zerborsten und Feuerzungen leckten nach draußen in den Tag. Ich stellte das Bäumchen auf dem Gehweg und setze mich erschöpft daneben.